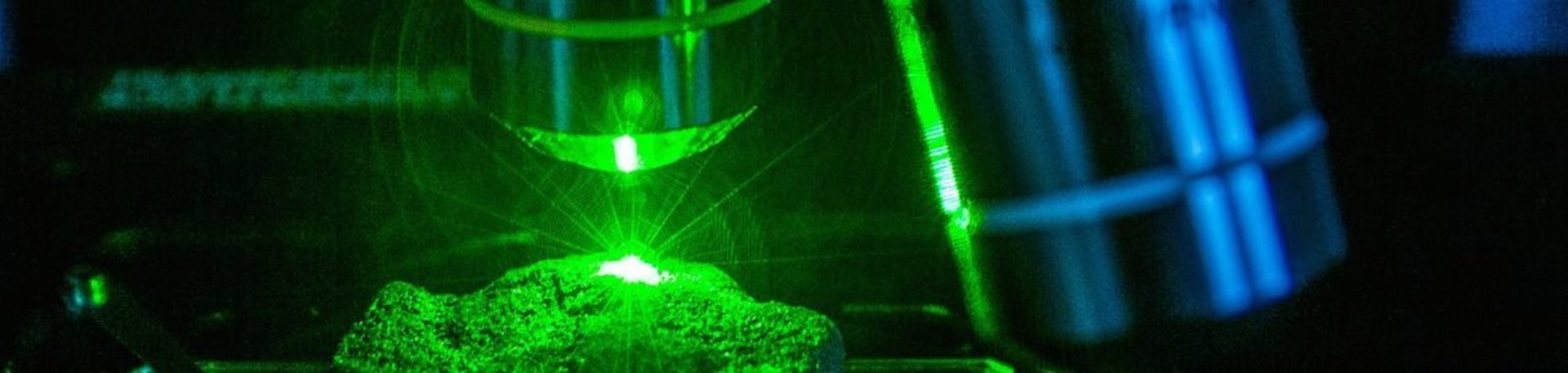Aktuelle Projekte
Ansprechpartner: Dr. phil. Johann Raith
Tel: +43 3842 402 6204
E-Mail: johann.raith(at)unileoben.ac.at
Büro: PTG/EG 009
Anprechpartner: Dipl. Ing. Dr. rer. nat. Ferdinand J. Hampl
Tel.: +43 3842 402 6214
E-Mail: ferdinand.hampl(at)unileoben.ac.at
Büro: PTG/EG 010
Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Dr. mont. Florian Altenberger
Tel.: +43 664 323 1437
E-Mail: florian.altenberger(at)unileoben.ac.at
Büro: PTG/EG 012
Ansprechpartner: Mag.rer.nat., Dr.rer.nat. Monika Feichter
Tel.: +43 3842 402 6213
E-Mail: monika.feichter(at)unileoben.ac.at
Büro: PTG/EG 014